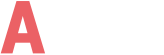Vorwort von Andreas
Am 1. März 1900 wurde Erich Robert Willi Tusche in Sprottau geboren. Im Alter von 14 Jahren begann die Zeit seiner kaufmännischen Ausbildung in Sprottau, wo er auch seine ersten Berufserfahrungen sammelte. Im Alter von 23 Jahren heiratete er Emma Marta Kunze aus Neusalz. Aus dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor. In den Wirren der unglückseligen Herrschaft des Dritten Reiches wurde er zu einem Sanitätssoldaten ausgebildet, wußte sich jedoch durch eine Bewerbung bei einem Betrieb in Neusalz bald wieder vom Militär zu lösen. Dennoch ist er im Alter von 45 Jahren in den Volkssturm aufgegriffen worden. Gut zwei Monate später geriet er in russische Gefangenschaft und durchlebte knapp vier unmenschliche Jahre in einem polnischen Bergwerk. Bei seiner Heimkehr fand er sich in dem Gesellschaftssystem der DDR wieder und mußte sich durch Gelegenheitsarbeiten über Wasser halten. Sein ausgezeichnetes Geschick in Fragen der Finanzbuchhaltung und Kenntnisse der Getreidelagerung brachte ihn jedoch nach sechs Jahren die Stellung eines erfolgreichen Planungsleiters in Rudolstadt ein. Dort verbrachte er noch zwölf Jahre, bis er schließlich als Rentner in die Bundesrepublik Deutschland aussiedeln konnte. Er starb im Alter von 86 Jahren in Köln.
In dem letzten Jahr seines Lebens sprach er seine Biographie auf ein Diktiergerät mit Tonband, da er fast erblindet war und nicht mehr Schreiben konnte. Sein gutes Gedächtnis hat er trotz dem hohen Alter von 86 Jahren behalten, so wußte er noch Namen und Daten die ja schon weit zurück lagen. Die Ereignisse der Gefangenschaft und die Zeit danach hat Ihn sehr belastet man spürt, er muß es sich mal von der Seele reden. Bruchstücke aus dieser Zeit hat er schon erzählt aber nicht so ausführlich wie hier. Leider sind von dem mehrstündigen Tondokument durch falsche Bedienung bei der Aufnahme nur knapp zwei Stunden aufgezeichnet worden. Der vorliegende Text ist die wörtliche Wiedergabe der erhaltenen Passagen. Der direkte Ansprechpartner in dieser Biographie ist sein Sohn Manfred.
Der vorliegende Text enthält nicht sämtliche gesprochenen Wörter, da oft Wiederholungen vorkamen. Grammatikalische oder syntaktische Inkorrektheiten wurden allerdings absichtlich im Text belassen. Die Gliederung in Kapitel, sowie deren Überschriften habe ich hinzugefügt.
– Andreas, Aachen, im Oktober 1993
Vorwort von Manfred
Ergänzungen und teilweise Änderungen im zeitlichen Ablauf sind von Manfred durchgeführt worden, außerdem wurden die Bilder eingesetzt, um unserem Enkel Paul Jannik, sollte er mal daran Interesse finden, alles besser verständlich zu machen.
– Manfred, Wiehl, im Januar 2004
Familienchronik
Hallo, heut’ will ich einmal etwas über die “Familienchronik” erzählen.
Die Familien Tusche waren vor 1880 in Daubitz (jetzt 02956 Rietschen ) beheimatet, dann in Sprottau , Schlesien.
Eltern von Erich
Mein Vater war Schneidermeister und hatte ein kärglichen Lohn, meine Mutter ging in eine Gaststätte zur Bedienung und war dadurch oft die halben Nächte weg, aber sie mußte sich ja auch etwas dazu verdienen. Mein Vater war bereits 1909 gestorben, als ich erst 9 Jahre alt war. Er hat schwer leiden müssen, lag 2 Jahre fest zu Bett, hatte sehr starkes Gelenkrheuma, und es war für ihn eine Gnade, im Alter von 54 Jahren dann erlöst zu werden.
Mein Vater hatte drei Brüder und zwar den Schuhmachermeister Otto Tusche in Weißwasser /Oberlausitz, Gustav Tusche, der Gastwirt war und den Gasthof “Zum Prälaten” in Weißwasser gepachtet hatte und Ernst Tusche in Görlitz , der Versicherungsvertreter war. Aus der Ehe meines Vaters und meiner Mutter waren sieben Kinder hervorgegangen, wovon eins im jugendlichen Alter gestorben ist. Meine Mutter erlebte auch nur 56 Jahre und starb im April 1918. Nun war ich ganz allein, denn ich war ja schon in der Fremde. (in Neusalz an der Oder)
Geschwister

Max und Richard sind nicht mit auf dem Bild
Max
Aber nun erst mal zu meinen Geschwistern: Da war als erster Max. Als erstgeborener hatte er nach dem frühen Tod der Eltern für die jüngeren Geschwister die Verantwortung übernommen. In Sprottau hatte er das Feilenhauerhandwerk bei Meister J. Baier erlernt, und 1903 die Gesellenprüfung abgelegt und war bis auf einen Unterbrechung durch den Wehrdienst bei seinem Meister im Dienst geblieben.
Im Oktober 1912, ein Jahr nach dem Tode seines Lehrmeisters, machte Max in Glogau die Meisterprüfung und arbeitete bis Kriegsausbruch bei der Witwe seines Meisters als Werkmeister weiter. 1921 nach dem Tode der Betriebsinhaberin erwarb er das Grundstück und den Betrieb, der in den folgenden Jahren modernisiert und als Schleiferei erweitert wurde.
Als die Feilenhauerei industriell betrieben wurde, hat er sich mehr mit dem Schleifen von gewerblichen Werkzeugen, Operationsbesteck und für den Haushaltsbedarf incl. Schlittschuhe beschäftigt und ein Ladengeschäft für Haushalts- und Geschenkartikel betrieben.
Dazu kam das er für das “Rote Kreuz” die Desinfektion und Schädlingsbekämpfung übernommen hat. Du Manfred bist bei unseren Besuchen in Sprottau mit Max auf diesen Fahrten gern dabei gewesen. Im schwarzen Opel P4 gab es noch kein Radio; da habt ihr kräftig gesungen um den lauten Motor zu übertönen. Aus der Ehe mit Margarete, genannt Grete, gingen 4 Töchter hervor: Magda, Lieselotte, Elfriede, und Anneliese.
Im 2. Weltkrieg wurde Max zum Sanitätsdienst bis zu seiner altersbedingten Entlassung eingezogen. 1945 mußte er zum Volkssturm und wurde nach der Gefangenschaft in Hoyerswerda nach Hitzacker entlassen. Grete ist mit den 4 Kindern im Februar 1944 vor den Russen nach Hitzacker geflohen.
Anfang 1946 richtete Max wieder eine Schleiferei ein und übernahm die Schädlings-Bekämpfung. Wie in Sprottau wurde er auch in Hitzacker wieder in der Schützengilde aktiv und gehörte zu deren Offizierskorps.
Max ist 1963 mit 78 Jahren in Hitzacker verstorben. Grete ist 3 Wochen später mit 82 Jahren gestorben.
Richard

Richard, ein sehr lustiger Bruder, hat sich als Möbel-Tischler selbständig gemacht. Während der Inflationszeit haben wir im den Auftrag für die Wohnzimmermöbel erteilt und im Voraus bezahlt, damit er das Material kaufen konnte. Als die Möbel fertig waren hatte das Geld keinen Wert mehr, und so habe ich alles noch einmal bezahlt. Richard zog dann nach Dresden , als Hausmeister in einer privaten Villa im Veilchenweg. Das Nebenhaus wo er mit Marta und deren Schwester Lina Jungnickel wohnte, wurde beim großen Angriff auf Dresden stark zerstört. Die Villa war bis auf zwei Angestellte und einer Tochter bewohnt die beim Angriff umgekommen waren. Der Besitzer war nicht im Haus sondern in seiner Firma in Leipzig.
Einige Tage nach seinem 79-jährigen Geburtstag, 1965, ist Richard verstorben. Er hatte einen schweren Tod, denn er hatte Speiseröhrenverengung und konnte nichts mehr essen, er ist also buchstäblich verhungert. Allerdings nehme ich an, daß es mehr Krebs gewesen ist, ohne daß es direkt mir bekannt wurde. Aus dieser Ehe war eine Tochter hervorgegangen, die aber auch sehr zeitig gestorben ist. Seine Frau Marta wurde dann wohl 86 oder 87 Jahre in Dresden. Lina verstarb am 30. Juni 1980 mit 88 Jahren.
Marta
Jetzt kommt meine Schwester Marta dran. Sie wurde 1891 geboren und heiratete erst im Jahr 1919 also mit 28 Jahren. Ihr Mann, Richard Zeisler war 15 Jahre älter als sie und er hat sich im Alter von ungefähr mit 65 Jahren, 1940 das Leben genommen. Aus dieser Ehe gingen zwei Söhne hervor, wovon einer heut noch in Holzminden an der Weser lebt. Ein anderer Sohn, der auch in Holzminden war, ist mit 52 Jahren, 1977 bei einem Segelflug abgestürzt und dabei tödlich verunglückt.
Marta wurde 82 und ist 1973 verstorben.
Arthur
Jetzt kommt der vierte dran, und zwar Bruder Arthur, der bei meinem Onkel, Otto Tusche in Weißwasser Schuhmacher gelernt hatte. Ich kann mich erinnern, daß ich ein Jahr in den Ferien einmal in Weißwasser verlebt habe - einige Wochen heißt das. Er kam mit seiner Schuhmacherei auch nicht so richtig vorwärts und ist dann zur späten Zeit zum Militär übergewechselt, daß er dort als Beamter oder so was ähnliches tätig war. Genau weiß ich es nicht. Dort sind zwei Töchter, Dorothea und Christa die in Hilden lebten. Übrigens, einschalten muß ich noch, daß Arthur etwas über 87 Jahre alt geworden ist und 1981 gestorben ist. Seine Frau Berta war einige Jahre zuvor 1970 im Alter von 77 bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
Alfred
Nun will ich mich erst übergehen und komme noch zum letzten, Alfred, der eigentlich etwas als schwarzes Schaf in der Familie galt, denn er konnte nirgends richtig Fuß fassen. Er kam in Sprottau in die Lehre, in dem Jahr, als meine Mutter starb, und zwar sollte er Buchbinder lernen. Er hat sich aber anscheinend nicht dafür geeignet und wurde wieder aus der Lehre genommen. Er hat sich dann so recht und schlecht durchgeschlagen, hat mal hier mal dort gearbeitet, alles Gelegenheitsarbeiten, aber nichts Festes. Bis er dann nach dem Kriege als Papierschneider bei Fa. Zanders in Bergisch Gladbach tätig war. Es wird Dir noch in Erinnerung sein, daß er bereits mit 75 Jahren, 1980 gestorben ist. Mit der Ehe von Else sind 3 Kinder, Sohn Siegfried und Töchter Brigitte und Erika, hervorgegangen.
Erich selbst
Zu mir selbst ist noch zu sagen, daß ich in der Schule gut vorwärts gekommen war und in der Niedermühle in Sprottau in die kaufmännische Lehre kam und zwar am 1. April 1914. Es war eine harte Lehre, aber ich habe dabei auch etwas gelernt. Nur, nach Beendigung der Lehrzeit, so war es dort üblich, mußte jeder Lehrling den Betrieb verlassen, und so hatte ich mich auf gut Glück in Neusalz in der Mühle Kopp um eine Stelle beworben, die ich dann auch zum 1. April 1917 erhalten habe. Umso schmerzlicher war es für mich, das ein Jahr später 17.04.1918 meine Mutter bereits starb und ich dadurch praktisch ganz allein dastand.
Nun ist in unserer Reihe bloß noch ich übrig, und das hatte ich ja in einem früheren Bericht bereits gesagt, daß Martel und ich 1923 geheiratet hatten. Allerdings vergingen fast sieben Jahre, ehe sich Ursula auf die Welt gewagt hatte und zwei Jahre später kamst Du, lieber Manfred, zu ihrer Gesellschaft.
Meine Frau Marta (Martel)
Wir hatten uns bei einer Hochzeit in Neusalz kennen gelernt. Martel war bei der Post bis zur Geburt von Ursula tätig. Wir hatten bald einen schönen Bekanntenkreis der sich bis zum Ende des Krieges immer noch vergrößert hatte. Wir unternahmen Wanderungen in den Oderwald oder auch kleine Touren mit den Fahrrädern. Anfangs hatten wir Euch mit auf dem Rad, Ursel bei mir hinten und Manfred bei Martel vorn. Später hattet Ihr eigene Räder, vor der Abfahrt mußten dann von mir erst alle Reifen aufgepumpt werden.
Schon in Rudolstadt und auch später in Köln mußten einige Krankheiten überwunden werden, u.a. Operation an der Schilddrüse.
Martel ist über 82 Jahre alt geworden ist und 1983 in Köln gestorben.
Kunze (meine Schwiegereltern)

Die Eltern von Martel: Ihr Vater, Paul Kunze war Bautischler und arbeitete in Sprottau, in Berlin als Modelltischler für Graugußformen und auch in Neusalz. Meine Schwiegermutter, Emma Kunze war im Jahr 1943 an Leberversagen mit 70 gestorben. Martel hatte einen Bruder, den Bäckermeister Albert Kunze, und eine Schwester Johanna die allerdings im Alter von 14 Jahren 1912 durch starke Verbrühungen, verursacht durch ein explodierten Kochtopf, gestorben ist.
Bei unseren Großeltern waren wir oft am Sonntagnachmittag. Wir Kinder hatten im Hof und Garten einen schönen Spielplatz. Im Hof war auch die kleine Werkstatt vom Opa Kunze in einer lang gestreckten Reihe von überdachten Schuppen darin die Hobelbank mit all den Werkzeugen die von Hand bedient wurden, elektrisch angetriebene Maschinen hatte ein Handwerker damals noch nicht. Opa hatte im Wohnzimmer ein Grammophon mit Federwerk und mit eingebautem Schalltrichter. Das gute Stück hatte ich beim Lösen einiger Schrauben zum Absturz gebracht. Eine schwere Stunde für mich.
In der Küche war der Kohle-Herd, Eßtisch und das Bett von Oma. Die Beleuchtung über dem Tisch ist eine Gaslampe. Oma hat sich mit Heimarbeit für die “Borste” durch sortieren von Schweineborsten, schwarze aus den weißen aussuchen, etwas Taschengeld verdient. Im Wohnzimmer das “Loriot”-Sofa mit Tisch, Radio “Volksempfänger” und das Bett von Opa. Über dem Sofa ein Bild mit röhrendem Hirsch!!
Mit 4-5 Jahren habe ich auf dem Kinderrad gelernt die Balance zu halten. Opa hat das Rad am Sattel gehalten. Er mußte immer bei mir nebenher hetzen. Einmal habe ich zurück geschaut, der Opa hatte mich nicht mehr gehalten, als ich das merkte war ich prompt auf die Nase gefallen. Ab da konnte ich selbständig Fahrrad fahren!!
Paul Kunze hatte sich nach dem Krieg, nachdem er nicht Pole werden wollte und aus Neusalz ausgewiesen worden war, auf der Landstraße zu Fuß erst bis Dresden dann nach Ebersdorf in Thüringen, hier waren Martel mit Euch Kindern untergekommen, durchgeschlagen. Das bißchen Hab und Gut, was er auf zwei Leiterwagen mitgenommen hatte, ist ihm unterwegs weggenommen worden, und so kam er ganz armselig in Ebersdorf an. Er war damals 74 Jahre. Es ist eine Gemeinheit, einen Mann von 74 Jahren auszuweisen. In Ebersdorf ging es ihm aber auch recht schlecht, besonders durch die Verhältnisse des Nachkrieges verursacht. Er starb 1948 im Alter von 75 Jahren während ich noch in Gefangenschaft war.
Albert Kunze hatte wiederum einen Sohn, Erwin, der im Krieg war und sollte, entweder im Jahr war es 43 oder 44 auf Heiratsurlaub kommen. Die Papiere waren aber nicht alle zusammen und da hat sich das etwas verzögert. Inzwischen ist er dann vermißt worden, also nicht mehr zurückgekommen und so stand der Albert mit seiner Frau Marta auch wieder allein da. Er wohnte zum Schluß in Markkleeberg bei Leipzig. Seine Frau starb, soweit ich mich erinnere, im Jahr 1965 im Alter von 73 Jahren. Albert hatte uns im Jahr 1968 in Köln besucht und ist im gleichen Jahr im Alter von 75 gestorben. Den Verlust von Erwin haben sie sehr betrauert, sogar auf ihrem Grabstein steht “Zum Gedenken an unseren lieben Sohn Erwin”.
Albert hatte die Bäckerei nicht in Neusalz. Wir sind öfters für einige Tage dorthin gefahren. Die frisch gebackenen Brote und Backwaren wurden mit einem geliehenen Pferdegespann, der einen Planwagen zog, zu den umliegenden Dörfern von der Verlobten vom Erwin gefahren. Ein herrliches Erlebnis wenn wir mitfahren durften. Der Duft der noch warmen Brote, das Zuckeln des Pferdes und die fröhliche Kutscherin. In Erinnerung eine schöne Ferienzeit.
So, nun wär’ ich bald am Ende. Es ist nun schon fast sieben Monate, daß meine gute Martel nicht mehr bei mir ist. Nun bin ich recht einsam und bin auch der letzte in der ganzen Generation. - Nächstens mehr.
Die Hochzeiten
Nun werdet Ihr Euch vielleicht noch gewundert haben, daß wir ausgerechnet am 22. Dezember 1923 geheiratet hatten. Das hatte auch seinen Grund. Ich wohnte doch möbliert bei einem Friseurmeister, und die benötigten das von mir bewohnte Zimmer, weil dort noch drei Töchter zuhaus’ waren. Und um mir nicht noch einmal ein anderes möbliertes Zimmer zu suchen, haben wir ganz kurz uns entschlossen, damals zu heiraten. Deswegen also die Hochzeit mitten im tiefsten Winter. Wir hatten selbstverständlich keine eigene Wohnung, sondern waren bei den Eltern Kunze untergebracht, etwas gedrängt, aber wir haben trotzdem die Sache durchgestanden, denn bereits im Oktober 1924 erhielt ich eine Neubauwohnung, die ja auch allerdings noch bescheiden war aber wir waren dann für uns nun allein.
Goldene Hochzeiten
Nun wäre noch eins zu berichten, und zwar: Bruder Max und Grete haben 1909 geheiratet, und hatten also 1959 ihre goldene Hochzeit, die sie in Hitzacker an der Elbe feierten. Von uns aus der DDR, also Richard und mir, war niemand eingeladen. Bruder Richard heiratete im April 1911 und feierte 1961 in Dresden seine goldene Hochzeit. Bruder Arthur heiratete im September 1919 und hatte seine goldene Hochzeit im Jahr 1969 in Hilden.
Wie ich schon erwähnte, ist der Mann von Marta Zeisler eher gestorben, so daß dort eine solche Feier weit entfernt war. Und bei mir war es so, daß ich die silberne Hochzeit in der Gefangenschaft, in der Grube verbrachte und die goldene Hochzeit, am 22. Dezember 1973 lag ich durch einen Herzinfarkt in Köln-Mehrheim im Krankenhaus und die Feierlichkeiten waren da auch recht sehr begrenzt. Bruder Alfred hat seine goldene Hochzeit nicht erlebt.
Die Ausbildung
So, nun will ich noch einiges vorab von meinem Werdegang erzählen. Meine weiteste Erinnerung reicht bis in das Jahr ungefähr 1905 oder -6 zurück. Als meine Großmutter starb und ich mit zur Beerdigung ging. Damals waren doch die Beerdigungen fast alle vom Trauerhause aus. Ich bekam einen neuen Matrosenanzug, und unterwegs flog ich in den Dreck, und die Schönheit des Anzugs war weg. So, das war die älteste Erinnerung.
Die Schulzeit
Wie ich schon vorher erwähnte, hat mir die Schule keine Schwierigkeiten bereitet. Ich durchlief alle Klassen und die Oberklasse doppelt, weil wir ja nur sechs Klassen und die Oberklasse in der Schule hatten. Zur Freude von meiner Mutter und mir, bekam ich zur Entlassung ein Stipendium aus einer Stiftung, die ein oder zwei Schulabgängern, die bedürftig waren, ausgehändigt wurden, und das war ich. Dadurch konnte meine Mutter mir zwei Anzüge zur Konfirmation und auch zur Prüfung kaufen.
Die Lehrzeit
Die Lehrzeit begann in der Niedermühle in Sprottau in der kaufmännischen Lehre und zwar am 1. April 1914. Am 1. August 1914 begann der 1. Weltkrieg der bis 1918 dauerte. Es war eine harte Lehre, aber ich habe dabei auch etwas gelernt. Wir standen am Stehpult und da ich dafür noch zu klein war kletterte ich auf eine Fußbank.
Es muß auch noch folgendes erwähnt werden, um einen Vergleich zu der heutigen Zeit zu ziehen. Als Lehrling bekam ich im ersten Jahr 5 Mark pro Monat, im zweiten Jahr 10 Mark und im dritten Jahr 20 Mark je Monat. Die Arbeitszeit betrug in der Woche sage und schreibe 71 Stunden. Denn von Montag bis Samstag von früh um sieben bis abends um sieben mit einer Stunde Mittag, das sind 66 Stunden und jeden Sonntag von früh um sieben bis mittags um zwölf, also nochmals fünf Stunden. Noch als eine Vergünstigung war, wir durften Sonntags zur Kirche gehen.
Berufsjahre
In der Mühle Kopp
Die Lehrzeit verlief, wie ich schon sagte, von 1914 (zu Beginn des 1. Weltkrieges) bis 1917. Und zwar war der Mühlenbesitzer ein ehemaliger Dragoner-Rittmeister. Dadurch läßt sich ja auch leicht erklären, daß auch im Kontor ein richtiger Kasernenhofton herrschte. Die Ausdrücke, die dort gebraucht wurden, von Seiten des Chefs, möchte ich nicht wiedergeben. Aber 1917 war meine Lehre beendet, und auf ein Schreiben an die Mühle Kopp in Neusalz, bekam ich den Bescheid, mich vorzustellen, und ich bekam die Stelle. Ich bezog als Anfang 110 Mark, bekam ausgezahlt ungefähr 105 Mark und bezahlte für ein möbliertes Zimmer mit Pension 70 Mark. Da fühlte ich mich ja schon als Krösus, daß ich noch über 30 Mark in der Tasche hatte.
Es war auch ein sonderbarer Zufall, daß ich ein Zimmer bekam, denn ich hatte auf gut Glück auch dort in einem Haus angefragt, und ein Zimmer war frei und vor allen mit Pension. Es war auch nicht weit von dem Mühlenbetrieb entfernt.
Nach ungefähr zwei Jahren wechselte ich dieses Zimmer und zog noch näher an den Betrieb, wo auch ein Zimmer frei wurde. Ich bezahlte dann allerdings schon 90 Mark, aber das konnte ich mir ja auch schon leisten, denn mein Gehalt war nur drei Monate lang mit 110 Mark, dann wurde es von selbst auf 125 Mark erhöht und es dauerte nicht lange, so daß ich nach einem Jahr, vielleicht - ich weiß es nicht genau - aber so 175 Mark bereits verdiente.
In der Mühle Kopp war es sehr, man kann sagen sehr demokratisch, denn wir wurden alle ungefähr eine halbe Gehaltsstufe höher bezahlt als normal. Dadurch verdiente ich auch recht gut und so kamen auch noch einige Vergünstigungen dazu, denn wir wurden Sonntags alle, die ganze Belegschaft mit Frauen oder Freundinnen, und in diesem Falle mit Martel, zum Entenessen eingeladen. Wir probierten den Wein, den Kopp ein ganzes Faß bezog. Und es fanden auch Betriebsfeste statt, zur damaligen Zeit eine große Seltenheit. Wobei wir ja auch circa 100 Mann waren, denn zu der Mühle gehörte ja noch eine zweite Mühle in Grünberg und eine Kartoffelflockenfabrik in Kontopp . Bei der Betriebsfeier wurde eine Kuh und ein Schwein geschlachtet und kann man sich vorstellen, daß wir alle ganz gut dabei gelebt haben. Beim Tanz war es allerdings etwas schwierig, denn auch ich mußte die Frau des Mühlenbesitzers, die Frau Kopp, einmal herumschwenken, und sie war eine Statur, na ja sagen wir, es werden wohl bald zwei Zentner gewesen sein. Jedenfalls gab es eine Anstrengung, sie einmal über den Saal hinwegzuschweifen. Aber auch das war ja vorübergegangen.
Allerdings möchte das eine noch erwähnen, daß Julius Kopp Stadtverordnetenvorsteher war, Ehrenbürger von Neusalz, Schützenmajor und überhaupt in anderen Stellen auch noch wie in der Mühlenvereinigung und so weiter tätig war. Er war ein sehr angesehener Mann und er war auch sehr loyal und er war auch zu uns Angestellten immer hilfsbereit.
Die Inflation
Nach dem 1. Weltkrieg 1918 entstand eine Hyperinflation, ein dramatischer Geldverfall durch Kriegskosten und Reparationsforderungen und es wurde zu viel Geld gedruckt und keine Währungsreform durchgeführt. Sogar die neue Ausgabe von Geldscheinen war aufgrund der schnellen Entwertung nicht mehr möglich; teilweise wurde nur der neue Wert quer aufgedruckt.
Nun hatten wir in der Mühle dann eine weitere Vergünstigung, daß wir unser Geld, was wir uns sparten, im Betrieb anlegen konnten und wurde bankmäßig verzinst und am Gewinn beteiligt, so daß du am Jahresende vielleicht vier Prozent Zinsen und drei Prozent Gewinn noch erhieltest. Eine weitere große Vergünstigung war, als die Inflation 1923 ihren Höhepunkt erreichte. Denn die Mark stand eins zu einer Billion - ja richtig, eine Billion - Nu rechne mal aus, wie viel Nullen da erst dran gehangen werden müssen.
Nun sagte ich schon, daß bei Kopp es sehr loyal zuging. Da hatte ich aber nun von der Inflation nicht viel zu befürchten, denn es war dort eingeführt worden, oder besser gesagt, man bekam alle vier bis fünf Tage Geld. Ein festes Gehalt existierte nicht mehr. Auch eine feste Miete, also meine Pension und so für mein möbliertes Zimmer, bestand nicht. Ich mußte mich da auch immer nach den Steigerungen richten. Nun war es uns in der Mühle möglich, von dem Gehalt, was wir heut’ bekamen, Roggen zu kaufen, der selbstverständlich nur auf dem Papier stand, denn den habe ich mir ja nicht etwa in den Sack eingeladen und mit nach Hause genommen. Wenn ich in fünf Tagen oder zehn Tagen Geld gebrauchte, konnte ich von dem Roggen, sagen wir mal 25 Pfund verkaufen, zu dem Preis, an dem er an diesem Tage war, so daß ich da die Inflation überbrückte und noch ganz gut dastand. Es war allerdings nur in der letzten Zeit, daß uns diese Vergünstigung gewährt wurde. Dadurch bin ich auch recht gut noch über die Inflation hinweggekommen. Wenn also heut von einer Inflation von drei oder vier Prozent gesprochen wird, dann muß ich im Vergleich zu damals nur noch darüber lächeln, denn wir haben wirklich eine echte Inflation, wie sie überhaupt nicht höher möglich war, durchgemacht.
Das Ende der Mühle Kopp
Leider ging der Betrieb 1925 in den Vergleich, denn es waren in der Familie Kopp neun oder zehn Kinder und der älteste, ein Marineoffizier, war dann auch mit im Betrieb, und der zweite Sohn hatte als Kaufmann gelernt. Mit dem war ein sehr gutes Auskommen, während mit dem ersten, dem Ernst Kopp weniger gut zu verhandeln war. Dieser hatte sich wohl auch auf größere Spekulationen eingelassen und der Betrieb ging krachen. Es wurde ein Vergleich angestrebt, und Weihnachten 1925, nachdem wir ja alle unsere Kündigungsschreiben erhalten hatten, bestand ich darauf, daß Klarheit bestand, ob man gehen mußte oder nicht. Es stand die Wahl zwischen Otto John, der war zwei Jahre älter als ich und mir, und die Entscheidung fiel zu meinem Gunsten aus, John mußte gehen, ich blieb noch im Betrieb. Der Betrieb hielt sich noch drei Jahre, bis 1928 der vollkommene Konkurs eintrat und ich dadurch meine Stelle verlor.
Ich ging dann zur Landmaschinenfabrik Kupsch in Neusalz. Aber davon werde ich das nächste mal erzählen, denn es wird mir heute zuviel, das alles zu berichten.
Bei der Landmaschinenfabrik Kupsch
Nun will ich einiges über meine Tätigkeit bei der Firma Kupsch erzählen. Es war ein Betrieb, der, man möchte sagen, kleinlich war. Der Chef, damals ungefähr Mitte 40 Jahre, war insofern schon weniger angenehm, weil er meine Gehaltsforderung nicht billigte. Ich mußte also, um eingestellt zu werden, schon mit meinem Gehalt zurückgehen. Später hatte er es sogar fertig gebracht, daß er herausbekommen hatte, daß Klein- und Handwerksbetriebe 20 Prozent unter dem Tarif bezahlen brauchten. Er hatte allerdings das nicht direkt an mir versucht, denn da hätte er auf Granit gebissen. Jedenfalls war der Betrieb an sich aber ziemlich vielseitig, den wir hatten außer den Landmaschinen, Pumpenbau, Elektrobau auch für Hochspannungen, dann Wasserleitungsbau, wo wir für ganze Dörfer Wasserleitungen gebaut und verlegt hatten, und Zentralheizungsbau. Also, es waren doch so allerhand Abwechslungen.
Ein Betrieb am Rand der Pleite
Bloß, wie ich schon sagte, der Chef war recht kleinlich, indem er zum Beispiel, wenn Du einmal weggingst vom Arbeitsplatz, er gleich da war und die Lampe mal ausknipste, daß die ja nicht mal fünf Minuten Strom verbrauchte. Es gab auch sonst verschiedene Reibereien, aber als erstes war das, der Betrieb war an und für sich pleite, denn es wurde ausschließlich mit Wechseln gearbeitet, die immer wieder verlängert wurden. Wechsel von Kunden, die bloß noch auf dem Papier standen, die überhaupt keinen bißchen Besitz hatten. Aber die Wechsel wurden ja von uns immer wieder eingelöst und verlängert, bloß die Zinsen dafür bezahlten wir. Dann war es auch so, daß der Betrieb an und für sich an die Banken verpfändet war, als Sicherheit für die Wechsel, und auch unsere eigenen Zahlungen wurden fast nur durch Wechsel beglichen.
Das Arbeitsklima
Ich kann mich an eine Sache noch erinnern, wo mir einmal der Kragen geplatzt war und ich sagte: “Wenn man hier wenigstens einmal ein Wort der Anerkennung finden würde.” Da entgegnete mir der Chef “Ja, soll ich sie etwa loben, wenn ich noch nicht weiß, wie morgen der Wechsel eingelöst wird?” Ich habe ihm darauf geantwortet “Haben Sie sich schon einmal darum gekümmert, wie die Wechsel eingelöst werden? Auch der Wechsel morgen wird eingelöst, daß kann ich Ihnen jetzt schon sagen!” Da hat er nichts mehr gesagt und ging still seiner Wege. Jedenfalls, es war ein nicht mehr gerade schönes Arbeiten. Wir waren im Büro außer mir noch drei Angestellte, dann drei Reisende und ein Elektromeister, ein Kupferschmiedemeister und ein Schlossermeister. Insgesamt waren wir ungefähr 40 Leute.
Umschuldungsverfahren
Mein Chef ist allerdings sehr zeitig gestorben, daß war im Jahre 1938, als ich meinen Urlaub an der Ostsee verbrachte. Und ich war zurückgekommen und früh, da klingelte es bei mir, und da war einer der Reisenden da und sage “Der Chef ist in dieser Nacht gestorben”, ich möchte in den Betrieb kommen. Ich hatte an sich noch Urlaub. Er hatte da einen Herzschlag wohl bekommen und war erst Mitte 50.
Nun waren in dem Betrieb drei Söhne. Vor dem Beginn des 2. Weltkrieges am 1. September 1939 war der älteste beim Militär, der zweite hatte sich gleich im Kontor festgesetzt, und der dritte war in der Werkstatt tätig. Als nun plötzlich der Tod des Kupsch Seniors eintrat, kamen die Banken selbstverständlich sofort und verlangten, daß ich Bankvollmacht bekam und auch ein etwas höheres Gehalt. Sie waren nämlich soweit, daß sie am liebsten den Betrieb hätten platzen lassen. Ich habe da zugestimmt, bekam die Bankvollmacht, aber ändern konnte ich ja selbstverständlich auch nichts daran! Wir waren von der Landwirtschaft so sehr abhängig, und die hatte ja kein Geld, denn zu der Zeit, vor dem 2. Weltkrieg, da liefen die so genannten Umschuldungsverfahren, wo die landwirtschaftlichen Betriebe umgeschuldet werden sollten, aber das zog sich ja wer weiß wie lang’ hin. Es waren ganz wenige, die in der Zeit, wo ich noch da war, geregelt wurden.
Jedenfalls bei Ausbruch des Krieges bekam ich sofort doch den Einberufungsbefehl und eine Reklamation fand nicht statt, weil sie ja den zweiten Sohn haben wollten und der wurde reklamiert, das wurde genehmigt auch, weil einer der Söhne ja bereits beim Militär war.
Das war wohl in kurzer Zeit das, was ich bei Kupsch erlebt habe. Wie gesagt, der Chef selbst war ziemlich kleinlich. Weihnachten da wurde so stillschweigend zwanzig, dreißig oder vierzig Mark überreicht, aber wenn dann du früh ein paar Minuten später kamst, da stand er schon da und klappte von seiner Uhr den Deckel auf, um nachzusehen, wie viel man wieder verspätet war. Und auch daß ich mich etwas mehr, als mein Vorgänger, an den Achtstundentag gehalten hatte, das war auch ein Dorn in seinem Auge. Trotzdem habe ich aber es von Oktober 1928 bis August 1939 ausgehalten.
Die Wohnungen
Julius-Kopp-Straße
Nun eine andere Sache bezüglich unserer Wohnung. Ich erwähnte wohl schon, daß wir im Jahre 1933 unsere kleinere Wohnung auf der Raudener Straße verlassen hatten und nach der Julius-Kopp-Straße gezogen waren. Ich hatte dort im ersten Stock neben der Mühle, das Wohnhaus gehörte auch zur Firma Kopp, eine Dreizimmerwohnung. Allerdings war die eine Stube unter der Tordurchfahrt, und da war es ziemlich kalt. Inzwischen war das Haus verkauft worden durch den Zusammenbruch der Familie Kopp. Ein gewisser Herr Scheibner, der einen Süßwarenhandel betrieb, hatte das Haus gekauft. Da beschwerte ich mich bei ihm eines Tages, daß es dort zu sehr zieht, ob er nicht das Tor tagsüber, wenn er nicht heraus fuhr, zumachen könnte. Da wurde mir glattweg gesagt, ich müßte mich daran gewöhnen, daß ich in einem Geschäftshaus wohne. Also ich hatte mich mit ihm überworfen und versuchte nun eine andere Wohnung zu bekommen.
Kirchstraße
Nun war in Neusalz die Familie Bär, ein Jude, auf der Kirchstraße mit seinem Haus, die Familie Bär hatte das Haus verlassen, beziehungsweise war durch die Nazisache nach Brasilien ausgewandert. Es waren sieben Zimmer, die in eine Drei- und eine Vierzimmerwohnung durch Korridor geteilt werden konnte. Das hatte ich erfahren, daß dort diese frei war. Nun wollte ich möglichst in diese Wohnung.
Es war wohl, wenn ich mich richtig erinnere, Anfang 1938. Da erfuhr ich, daß der Hausverwalter im Gefängnis saß. Es war ein Sparkassenangestellter, der Dummheiten begangen hatte. Tja, wie sollte ich aber an den ran kommen, denn so ohne weiteres war ja das nicht möglich? Nun hatte ich ferner erfahren, daß seine Verteidigung Herr Rechtsanwalt Preuß übernommen hatte. Die Rechtsanwälte in Neusalz waren mir ja durch die Prozesse, die ich am Gericht führte, auch alle bekannt, also auch Herr Rechtsanwalt Preuß. Folglich ging ich eines Tages zu ihm, und er empfing mich mit den Worten “Na, Herr Tusche, was kann ich denn für Sie tun?” Ich sagte, “Sie können mir zu einer Wohnung verhelfen.” Da hat er mich groß angeschaut und sagte “Daß weiß ich wirklich nicht, wie ich dazu komme?” “Doch”, sagte ich, “Sie vertreten doch den Herrn Richter, der im Gefängnis ist.” “Ja.” Ich sag “Und der Mann hat nun die Vergabe der Wohnung auf der Kirchstraße von dem Bärschen Haus.” “Tja, ha, wissen se,” meint er “da ist das einfachste, wir gehen einmal zu ihm ins Gefängnis!” Ich sagt’ “Kann ich denn da ohne weiteres mit?” “Na”, meint er “das lassen Sie mal mich besorgen!” Und in der nächsten viertel Stunde waren wir im Gefängnis. Der Wächter schaute erst nach mich und das regelte Preuß sofort, daß er sagte “Der kommt mit mir mit!” Nun hat Preuß und auch ich den Richter dort bearbeitet, daß er uns die Wohnung gab. Nach langem hin und her meinte er “Na ja, ich habe nichts einzuwenden, Sie können die Wohnung haben.” Ich hatte mich für die Dreizimmerwohnung entschieden. So hatte ich also eine Wohnung im Gefängnis gemietet, was bestimmt nicht alle Tage vorkommen wird.

Wie Du Dich vielleicht erinnerst, war es eine sehr schöne Wohnung in der ersten Etage, es waren sehr schöne Räume und sie war auch bereits etwas neuzeitlicher eingerichtet. Das Haus ist gelb verklinkert mit roten Ziegeln noch verschönert.
Jedes Zimmer hat einen Kachelofen. Im Eßzimmer stand Dein Bett, das glänzend schwarzlackierte Klavier und ein Eßtisch mit einem Sofa und ein Bücherschrank. Das Klavier wurde auch von Euch benutzt, denn Ihr hattet Unterricht bei Frau Schindler am Schmuckplatz. Du Ursula hattest mehr Begabung und hast ja dann auch auf der Orgel gespielt.
Das Wohnzimmer, es wurde in Schlesien das gute Zimmer genannt, war mit einem Schreibtisch einem großen Tisch und einer Anrichte für Geschirr, Gläser und Tischwäsche eingerichtet. Diese Eichenmöbel, dunkel gebeizt, hat mein Bruder Richard während der Inflation angefertigt.
Im Elternschlafzimmer war auch das Bett von Ursula durch eine spanische Wand getrennt. In der Verbindungstür vom Schlafzimmer zum Wohnzimmer hing Eure Schaukel. Das Bad mit Toilette war ein halbe Treppe tiefer im Haus. Da die Häuser nicht isoliert waren, konnte es passieren daß im Bad bei strengem Frost die Leitung platzte, denn der Kohleofen für Warmwasser wurde ja nur am Wochenende beheizt. Wir hatten deshalb einmal Eis auf dem Fußboden!
In der Küche gab es keinen Kühlschrank, die Brauerei lieferte im Sommer so alle Woche einen Eisblock der unter dem Schrank vom Fenster die Lebensmittel frisch halten mußte. Hier war auch der Eßplatz denn im Wohnzimmer wurde nur zu Festzeiten oder bei Besuch gegessen. Der Herd wurde mit Holz oder Kohlen geheizt, daneben gab es noch ein Gasherd, und später ein Heiz- und Backofen der mit Koks (Grudeofen) beheizt wurde.
Dazu gehörte auch ein großer Keller denn für Kohlen und Kartoffeln wurde entsprechend viel Platz benötigt. Im Hinterhof gab es noch zwei Häuser außerdem hatten wir die Garage für Fahrräder, Leiterwagen und Deinen fliegenden Holländer (Vorläufer vom Kettcar).
Für Euch Kinder war der Hinterhof ein prima Spielplatz mit Sandkasten und Kletterbaum. Die Waschküche ein kleines Gebäude mit großem Kupfer-Kessel in dem die kochende Wäsche mit einem Stampfer durchgewalkt wurde, konnte von Martel so jeden Monat einmal benutzt werden, ein voller Tag der viel Kraft kostet. Die großen Wäscheteile wurden mit dem Leiterwagen zur Kaltmangel gefahren, die von Hand von Euch Kinder oder auch von Oma Kunze betätigt wurde. Wir sind in dieser Wohnung bis zur Flucht im Februar 1945 geblieben.

Einen kleinen Garten hatten wir ganz in der Nähe dazu gemietet. Opa Kunze hat dort eine Gartenlaube aufgebaut da haben wir Männer Skat gespielt. Eine Dusche gab es auch, das war eine hochgehängte Gießkanne. Ihr Kinder habt in dem Garten viel Zeit verbracht und in der Zinkbadewanne Spaß gehabt.
Das Schwimmbad, in dem ihr auch die Freischwimmerprüfung gemacht habt, war in der Oder; hier wurden die Becken durch schwimmende Pontons abgeteilt. Das Nichtschwimmerbecken hatte einen Holzfußboden, sodaß ihr Kinder nicht unter die Pontons kommt. Im Schwimmerbecken war auch ein Dreimeter Sprungturm den Ihr zur Prüfung benutzt habt!
Ein weiterer schöner Spielplatz war der Hafen, in dem immer die verschiedensten Schleppkähne lagen. Ihr durftet auch auf die Schiffe kommen und mit den Kindern der Eigner toben.
Am Ende der Kirchstraße war der Metzger und nicht weit davon ein aufgeschütteter Hügel, direkt am Ufer der Oder. Dort habt Ihr auch viel gespielt, im Winter bei Schnee die ersten Schlittenfahrten gemacht und später auch mit den Schiern geübt. Schlittschuhlaufen ging nicht auf der Oder sondern nur auf dem zugefrorenem Teich. Einmal bist Du Manfred eingebrochen und kamst mit steifgefrorener Kleidung nach Hause. Mit einem warmen Bad und heißem Tee hast Du keine Erkältung davon getragen.
1991 nach dem Ende der DDR bin ich mit Erika über Görlitz nach Neusalz und Sprottau gefahren. Wir haben das Haus mit dem “Sandkasten” die Schulen und das Krause-Werk, den Schmuckplatz alles wieder gefunden. Die ganze Stadt machte einen sehr guten und gepflegten Eindruck. Das Haus von Opa Kunze gab es nicht mehr, da stand ein Plattenbau.
In Sprottau war viel nicht wieder aufgebaut worden, die Zerstörung durch die Verteidigung von Sprottau war überall zu sehen, nur das prächtige Rathaus am Marktplatz war unversehrt. Das Haus von Max haben wir nicht gefunden, nachträglich haben wir erfahren, daß es ebenfalls zerstört war.
– Manfred
Kinderkrankheiten
Ursula
Die schwerste Krankheit war im Jahre 1937/38 mit Scharlach, eine ansteckende, langwierige Krankheit. Du Manfred hast in dieser Zeit bei den Großeltern Kunze gelebt und durftest nur mal von weitem Ursula im Wohnzimmer sehen. Für Ursel war strengste Bettruhe angesagt, so daß nach abklingen des hohen Fiebers und Ausschlag der Körper sehr geschwächt war. Um den Eßzimmertisch hast sie wieder laufen gelernt. Die komplette Wohnung und die von Ursel gebrauchte Wäsche mußte speziell desinfiziert werden.
Manfred
In der Kindheit bis zum 10. Lebensjahr hattest Du einige Kinderkrankheiten. Angefangen mit Mumps, beidseitige Ohrenvereiterung mit Aufstechen der Trommelfelle, und drei Lungenentzündungen.
Du bist mit Martel öfters nach Glogau zu einem Heilpraktiker gefahren der Dich gut behandelt hat.
Die Militärzeit
Einberufung
Nun will ich noch etwas über meine Militärzeit berichten. Am 27. August 1939 mußte ich zum Militär und zwar nach Freystadt , wo ein Lazarett aufgebaut wurde. Ich wurde also zu dem Sanitätshaufen beordert, und durch einen besonderen Umstand und einen Glücksfall kam ich sofort in die Schreibstube von dem Truppenkranken Növea. Wir waren, außer dem Feldwebel, noch drei Leute und der Oberarzt Dr. Schütz und Assistenzarzt Dr. Welkem. Oberstabsarzt war Dr. Wünsche, der ja die ganze Sanitätsabteilung unter sich hatte. Es wurde auch ein Art Lazarett aufgebaut, in welches dann kurz danach polnische, verwundete Gefangene eingeliefert wurden.
Vorgesetzte
Nun war die Militärzeit für sich, an sich keine schlechte Zeit. Im Gegenteil, es war ein ruhiger Betrieb. Ich machte meine Schreibarbeit. Im Grunde genommen machte ich den Feldwebeldienst, denn der Feldwebel war im Schreiben sehr ungeschickt und machte der dafür meinen Sanidienst.
Es waren nun täglich dort die Untersuchungen aus dem ganzen Militärkomplex und der Oberarzt Dr. Schütz, der später zum Stabsarzt befördert wurde, war ein, na, ich will mal sagen, etwas stark zugreifender Arzt, der nicht so sehr empfindlich war. Aber er hatte auch dadurch erhebliche Vorteile gegenüber dem anderen Arzt. Wir verstanden uns sehr gut und das merkte ich auch daran, daß er zum Beispiel eines Tages Mittag laut nach mir rief; ich ging nach oben und da mußte ich mit ihm zusammen eine Tasse Tee trinken und eine Zigarre rauchen. Wenn er zum Oberstabsarzt ging, mußte ich immer mitgehen und da wußten die schon, wenn einer auftauchte, da ist der andere nicht weit.
Nun, wie gesagt, dadurch Freystadt ja bloß zwölf Kilometer von Neusalz entfernt war, war ich jeden dritten Sonntag in Neusalz, und die anderen Sonntage wart Ihr ja auch bei mir in Freystadt mit den Fahrrädern, wo ich Euch gut versorgt habe.
Als Soldat auf Stellensuche
Wie ich aus einem vorigen Bericht schon erläuterte, waren bei Kupsch zwei Söhne und das gab mir zu bedenken, daß eines Tages ich bei Kupsch überflüssig werden würde, wenn alle drei im Betrieb tätig waren. Und eines Tages traf ich den Direktor Pauli vom Krause-Werk/Neusalz während eines Sonntagurlaubs. Und ich fragte ihn, wie es ist, ob sie im Betrieb, also im Krause-Werk, etwa jemand in der Buchhaltung brauchten. “Ja” meinte er, “bewerben sie sich doch mal!” “Ja”, ich sag “Herr Direktor, ich bin ja aber jetzt Soldat.” “Na ja, das wird sich dann schon finden.” Nun, schön, also ich habe mich beworben, mußte nach Neusalz mich vorstellen kommen. Herr Generaldirektor Dr. Teusener wollte mich auch kennen lernen und ich war eingestellt in der Abteilung Buchhaltung für besonders das ganze Inventar im ganzen Betrieb, was auf Karteikarten umgeschrieben worden war. Und es war auch eine ganz angenehme Arbeit.
Aber ich war ja noch Soldat. Und da habe ich die Ehrlichkeit begangen, daß ich zum Oberstabsarzt gegangen bin und habe ihm gesagt, daß eine Reklamation für mich kommen würde. Ich denke der frißt mich auf! “Sie sind wohl verrückt geworden! Wie können Sie sich um eine Stelle bewerben? Ich werde Sie einsperren lassen!” Und hat mich herunter gedrängt, wer weiß wie sehr. Ich habe ihm nur geantwortet “Oberstabsarzt, das war ich mir und meiner Familie schuldig. Im Übrigen habe ich aber nicht gewußt, daß eine Reklamation kommt und hatte immer angenommen, daß die Stelle für mich nach Beendigung des Krieges sein würde!” “Na ja,” meinte er dann “da tun Sie aber mal ihren Nachfolger gut einarbeiten, daß mir da ja die Truppenkrankennachweise richtig bearbeitet werden und mir keine Reklamationen deswegen kommen!” Und, wie gesagt nach einem Jahr und zwei Monaten war ich wieder frei. Ich mußte nach Breslau zur Entlassung und das war Ende Oktober und am 29. Oktober 1940 habe ich dann im Krause-Werk angefangen.
Nun hier noch einige Bemerkungen während meiner Militärzeit. Eines Tages mußte ich zum Oberstabsarzt kommen – und wer stand vor mir? Mein Bruder Max aus Sprottau als Oberfeldwebel oder, besser gesagt, als Sanitätsoberfeldwebel und der Oberstabsarzt gab mir die Anweisung meinen Bruder aus Sprottau in das ganze Krankengeschehen und die Abrechnung das alles einzuweisen. Wir haben dann beide darüber gelacht.
Saniprüfungen
Nun noch etwas anderes, dabei auch: Ich mußte doch beim Militär einen Kursus als Sanitäter mitmachen, damit ich Sanitätssoldat wurde. Nun, bei der ersten Prüfung, die mündlich stattfand, hatte der unterrichtende Arzt mich ausgesucht, und ich mußte einen Bericht geben über die Sanierung was bei mir, weil ich ja mit dem Kopf ganz gut war, am fließenden Band kam. Dadurch war die Sache dort bereits erledigt, und ich hatte alle anderen mit herausgerissen. Nun kam aber die praktische Prüfung, da habe ich den anderen gesagt “Jetzt müßt ihr mich aber herausreißen, denn im Praktischen seid Ihr mir ja überlegen!”
Nun schön, das war an einem Vormittag, da wurden im Gelände einige von Soldaten hingelegt, mit einem Schild dran und dieser oder jener bekam den Auftrag, zu diesem oder jenen zu gehen und ihn zu behandeln. Ich hatte mit vier Mann zusammen an einer Stelle wo ein Soldat lag mit dem Schild “Lungendurchschuß”. Nun haben wir ihn verbunden, indem wir ein luftdichtes Verbandspäckchen erst auf die Wunde gelegt hatten und dann weiter verbunden. Als der Oberstabsarzt und sein Gefolge, als Prüfer nun ankam, wurde die Frage gestellt “Was hat der Mann?” Niemand antwortete, folglich mußte ich wieder antworten, sagte “Lungendurchschuß”. “Nun, was haben Sie da gemacht?” Niemand antwortete, habe ich’s ihm nun erklären müssen, und es war gut gegangen. Also war ich Sanitätssoldat.
Berufszeit im Krause-Werk
Nun kommt die Zeit, wo ich im Krause-Werk tätig war. Hier wurden Stahlteile hergestellt und weiter verarbeitet. Da es auch ein Rüstungsbetrieb war, durfte darüber, was wirklich hergestellt wurde, nicht gesprochen werden. So habe ich Euch erzählt es werden Kochtöpfe produziert.
Wie ich schon kurz erwähnte, war ich in der Buchhaltung als quasi zweiter Abteilungsleiter. Es war ein angenehmes Arbeiten, und es war auch nicht etwa so, daß wir uns überschlagen hätten. Es war insbesondere meine Aufgabe, so und soviel Belege zu kontrollieren und abzuzeichnen und die Kartei in Ordnung zu bringen, welche das gesamte Inventar verzeichnete. Ich bekam als einer der wenigen einen Ausweis, daß ich im gesamten Betrieb herumgehen konnte, in sämtliche Werkstätten und überall. Also, wie gesagt, dieser Ausweis ist an sehr wenige im Betrieb vergeben worden. Ich war nun dort, dann bis zum Februar 1945 und es war insofern auch eine ganz schöne Zeit, da ich die Abrechnung mit den Lebensmittelkarten für die vielen Gefangenen hatte, da ist auch für mich etwas abgefallen.
In der Zeit haben Ursula und auch Du Manfred mich öfters am Werktor abgeholt, da ich zum Mittagessen nach Hause kam. Es war ja auch ganz Nähe von den Schwiegereltern Kunze.
Da viele Männer fehlten, habe ich eine zweite Stelle angenommen, wo ich am Abend und zum Wochenende die Buchhaltung in einem kleinen Betrieb gemacht habe. Du Manfred hast mich oft begleitet und an der Schreibmaschine und Rechenmaschine “gearbeitet”.
An manchen Wochenenden und auch Abends, kurz vor der Flucht, mußten wir die noch in Neusalz gebliebenen Männer entlang dem Oderufer Schützengräben ausheben. Damit sollte der Russe aufgehalten werden. Zum Glück wurde Neusalz nicht verteidigt so sind alle Brücken und auch die Stadt unversehrt geblieben.
Flucht aus Neusalz
Am 2. Februar 1945 habt Ihr dann Neusalz mit dem letzten Zug verlassen, aber da brauch’ ich ja nichts erst darüber erwähnen, daß hast Du, lieber Manfred, ja sicher auch noch im Gedächtnis. Ihr seid drei Nächte mit vielen Aufenthalten, die durch Tiefflieger verursacht wurden, bis Thüringen gefahren.
Ihr wurdet erst in Ebersdorf/Kreis Lobenstein, bei Frau Holstein in einem Einfamilienhaus in einem Zimmer untergebracht. Thüringen wurde von den Amerikaner besetzt, aber später durch Tausch gegen einen Teil von Berlin, an die Russen abgegeben.
Ebersdorf
Das Haus von Frau Holstein lag an einem großen Park, der zum Schloß Zinzendorf gehörte. Das war für uns Kinder ein toller Abenteuer-Spielplatz. Die Russen hatten direkt hinter dem Haus die Panjewagen mit den Pferden dort abgestellt. Anfangs haben wir Ursel vor den Russen verstecken müssen. In dem Dachzimmer gab es zwei Tapetentüren, die führten in das nicht ausgebaute Dach, dort hat sich Ursel versteckt. Auch den Schmuck, Uhr und Sparbuch haben wir dort vor den Russen versteckt.
In Ebersdorf beherrschte die Herrnhuter Brüdergemeine mit den großen langgestreckten Häusern den Ort. Nach einiger Zeit bekamen wir ein größeres Zimmer im Schwesternhaus und später eine kleine Wohnung im Brüderhaus mit Garten. Im Schuppen hatte ich zwei Kaninchen, die Opa Kunze geschlachtet hat. Wir Kinder gingen in die neugegründete Zinzendorfschule der Brüdergemeine. Ursula hat den Abiturabschluß dort abgelegt. Aus Geldmangel bin ich dann in die zweiklassige Volksschule bis zum 8. Schuljahr gegangen.
Wir hatten sehr guten Kontakt zum Pfarrhaus Burckardt, eine kindereiche Familie. So waren wir oft zusammen; unter anderem sind wir zur Saaletalsperre zum Baden gegangen.
Die Konfirmation von Manfred fand am 30. März 1947 in der Brüdergemeine statt.
Nach dem Schulabschuß bekam ich keine Lehrstelle, so hatte ich mit Gelegenheitsarbeiten, wie Strohschuhe nähen ein kleines Taschengeld verdient, bis wir eine Stelle als Bäckerlehrling auf einem Dorf fanden. Dort habe ich es aber nur 4 Wochen ausgehalten.
Berlin
Pfarrer Burckardt hatte erfahren, daß in Berlin-Spandau , Westsektor, die Diakonvorschule im evangelischen Johannesstift eröffnet wurde. Da gleichzeitig eine Lehrstelle mit angeboten wurde bin ich 1948 dorthin. Die Lehrstelle als Werkzeugmacher fand ich bei Firma Klüssendorf in der Zitadelle-Spandau. Hier wurden Poststempelmaschinen und Wertzeichengeber für die Post gebaut. In dieser Zeit wurde von den Russen die Berlin-Blockade angezettelt, so mußten die Westsektoren über Flugzeugtransporte versorgt werden. Nach der Lehrzeit, September 1951, wollte keiner der Jungen aus der Diakonvorschule als Diakon im Johannesstift ausgebildet werden. In die Ostzone zurück wollte ich nicht, so bin ich über Stuttgart , dann nach Nagold , am Rand vom Schwarzwald bei der Firma Dau, Hersteller von Drehkondensatoren für Radios, drei Jahre als Werkzeugmacher angestellt worden.
– Manfred
Im Volkssturm
Ich selbst mußte noch in Neusalz bleiben und am 10. oder 11. Februar 1945 habe ich auch dann Neusalz mit einem Trupp von dem Krause-Werk, wir waren ungefähr noch 40 Mann, die wir dableiben mußten, uns von Neusalz abgesetzt und sind mit den Fahrrädern losgegondelt. Bis wir am 25. Februar 1945 in Meißen in den Volkssturm aufgegriffen wurden. Ich war also dann in der wertvollsten Truppe, denn der Volkssturm hatte “Gold im Mund, Silber im Haar und Blei in den Knochen!” Und wir sollten Deutschland retten!
zerstörtes Dresden
Ehe es dazu kam, daß wir in Meißen in den Volkssturm eingegliedert wurden, hatte ich mich von unserer Truppe abgesetzt und bin mit dem Fahrrad allein nach Dresden zur Wohnung von Richard im Veilchenweg gefahren, um Euch zu suchen, weil ich nicht wußte, ob Ihr etwa doch nach Dresden gegangen seid.
Ich fand selbstverständlich ein vollkommen zertrümmertes Haus vor, wie überhaupt Dresden vollkommen in Schutt und Asche lag, und mußte wieder umkehren. Wie viel hunderttausend Menschen dort ums Leben gekommen sind, wird sich nie feststellen lassen. Ich habe nachträglich einige verbotene Bilder gesehen, wie die Leichen auf dem Altmarkt in Dresden verbrannt wurden und alles verwüstet war. Es war einfach furchtbar. Und das, was sich der Amerikaner und der Engländer dort geleistet hat, ist eigentlich überhaupt nicht zu beschreiben, denn der Krieg war um diese Zeit ja längst entschieden.
Zum Glück fand ich an dem Haus, wo Richard gewohnt hatte, die Anschrift von dem Besitzer in Leipzig, und habe dann an den Besitzer geschrieben, um zu erfahren, ob Ihr dagewesen seid, erhielt aber die Nachricht, daß ihm nichts bekannt war, daß Richard Besuch hatte. Erwähnen möchte ich noch, daß auch durch den Angriff zwei Hausangestellte und eine Tochter von dem Besitzer dabei ums Leben gekommen waren.
Im Baubataillon
Ich begab mich nun wieder mit dem Fahrrad nach Meißen zurück und dort wurden wir an dem gleichen Tag in den Volkssturm eingegliedert, also sagen wir besser hinein gepreßt. Wir waren zunächst in Meißen untergebracht, und da hatte ich meine Zivilsachen bei einem gewissen Ilschner in Okrlilla bei Meißen untergebracht, der auch beim Volkssturm war. Ich hatte dann später Richard beauftragt, die Sachen dort abzuholen, doch inzwischen waren sie alle durch die Tschechen schon geklaut worden.
Unsere Tätigkeit beim Volkssturm bestand lediglich darin, daß wir als Baubataillon tätig waren, obwohl ich auch nicht einmal eine Schaufel in der Hand hatte, denn sie hatten mich dort zum Gruppenführer ernannt, und da hatte ich mich etwas um die Verpflegung gekümmert und sonst um überhaupt nichts. Mit dem Gewehr habe ich einmal ein Schwein zu unserer Verpflegung erschossen!
Wir wanderten von einem Ort zum anderen und waren immer dann im Kreis herum, waren zweimal über den Erzgebirgskamm geklettert und wieder zurück; und so ging das bis Anfang Mai. Da wollten wir noch nach Karlsbad ausweichen, unsere ganze Kompanie heißt das, aber der Amerikaner, der dort war, der nahm keine Gefangenen mehr auf. Folglich mußten wir wieder zurück. Und am 8. Mai 1945 gingen wir geschlossen in Klöstertle an der Eger in russische Gefangenschaft.
In Gefangenschaft
Im Behelfslazarett
Es war zunächst eine ganz furchtbare Zeit. Ich habe in Kobolto(?) oder Karben(?), ich weiß es jetzt nicht, auf der Straße, auf dem Pflaster gelegen und etwas geschlafen, und später wurden wir dann in Trupps zusammengestellt und weiter befördert. Als wir kurz vor Dresden waren, konnte ich nicht mehr weiter und mußte auf Anweisung eines Russen am Straßenrand mich hinsetzen, wo ich dann in ein Behelfslazarett gebracht worden bin. Dabei hatte ich aber Gelegenheit, an Richard einen Zettel zu schreiben und ihm mitzuteilen, wo ich bin, und den Zettel hat auch Martel dann noch von ihm erhalten, beziehungsweise die Nachricht, was mit mir ist.
Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, daß ich von Meißen aus dann versucht hatte, weiter Verbindung zu Euch zu erhalten, indem ich nach Gößnitz geschrieben hatte und von dort den Bescheid erhielt, daß Ihr Euch nach Ebersdorf in Thüringen abgesetzt hättet. Daraufhin habe ich an das Einwohnermeldeamt in Ebersdorf in Thüringen geschrieben, und dadurch bekam ich wieder Verbindung zu Euch.
Im Durchgangslazarett
In dem Behelfslazarett, einige einfache Baracken, umgekippte Schränke als Schlafstätte, waren wir ungefähr 14 Tage, dann wurden wir alle mit einigen LKWs nach Sorrau verfrachtet und bauten dort ein Durchgangslazarett auf. Ich hatte nun doch eine Binde vom Roten Kreuz bei mir, allerdings nicht abgestempelt, und da hatte ich mich in dem Lazarett gemeldet, als Sanitäter, und wurde dort auch eingestellt. Dabei hatte ich Bekanntschaft mit einer Schwester, die die Magda Vierich (eine Tochter von Max) kannte, indem sie mit der in die Schule gegangen war. Die Schwester hat mir auch praktisch das Leben gerettet. Es war nämlich eine Seuchenstation, und eines Tages hatte ich mich auch mit Typhus angesteckt. Sie gab mir aber bald entsprechende Medikamente, die noch da waren, und dadurch ging auch das an mir vorüber.
Einige Zeit später wurden wir von Sorau nach Sagan geschickt, das große Gefangenenlager in Sagan. Inzwischen war das Gefangenenlager Sagan und noch zwei andere an die Polen übergeben worden. Bei einer Untersuchung wurde ich aber nicht zurückgeschickt, wie es einem ganzen Teil noch erging, sondern ich wurde doch noch für tauglich befunden, und so kamen wir Anfang Oktober mit einem Zug, mit einem Viehwagen mit Stroh, nach Kattowitz und nach Myslowitz in Oberschlesien, wo ich dann in das polnische Kohlenbergwerk eingefahren bin.
Im Bergwerk
Wir waren 520 bis 620 Meter Untertage. Das Milieu dort war ja nun alles andere als schön, und den Polen, denen ja die Grube nun gehörte, waren auch alles andere als das, was man erwartet hatte. Es gab sehr anständige Menschen dabei, es gab aber auch ganz große Schweinehunde. So kann ich mich erinnern, daß ich Anfang Januar 1946 mich am Bein verletzt hatte und dort in das Krankenrevier kam. Da bin ich bei vollem Bewußtsein am Bein geschnitten worden, und einige Tage darauf kam der Kommandant und beorderte alle, die nicht Fieber hatten, und ich hatte kein Fieber, zur Arbeit. So sollte ich am nächsten Tag wieder in die Grube einfahren. Am nächsten Tag war ich aber wieder so schwach, daß ich ins Revier mußte und dort zusammengebrochen bin. Ich sollte dann nach Hindenburg oder nach Beuthen /Oberschlesien ins Lazarett gebracht werden, aber ich habe mich trotzdem durchgebissen, und der Unterarzt, der uns dort behandelte, sagte nachträglich zu mir, er hätte für mich keine fünf Pfennig mehr gegeben, so fix und fertig war ich.
Von meinem dreieinhalbjährigen Aufenthalt in der Grube wäre ja nun viel zu erzählen, aber an alles kann ich mich auch nicht mehr so recht erinnern, und es würde auch einen viel zu großen Raum einnehmen, wenn ich das alles hierauf sprechen würde. Nur einige Beispiele:
Die 5. Abteilung
Nachdem ich wieder so einigermaßen gesund war, wegen der Verletzung am Bein, wurde ich angeblich, “angeblich” sage ich, grubenuntauglich geschrieben, aber eines Tages kam einer und meinte “Du mußt morgen früh zur 5. Abteilung einfahren.” Die 5. Abteilung war die schwerste Abteilung in der ganzen Grube. Meine Erwähnung, daß ich doch grubenuntauglich geschrieben bin, wurde bloß damit abgetan, ja, das gilt nur, wenn Ersatzmann für mich da war, und der war ja eben nicht da. Jedenfalls fuhr ich am nächsten Tag, gezwungenermaßen ja, in die Grube ein, zur 5. Abteilung, wo ich überhaupt noch nicht gewesen war, denn ich war zuerst bei der 13. Abteilung und war mit einem Maurer zusammen, wo wir Dichtungen anbrachten und Stempel setzten, also Holzstöße setzten und so weiter und so fort.
Jedenfalls fragt’ ich bei der 5. Abteilung einen der Miteinfahrenden, wo ich nun hier eine Schaufel her bekomme. “Tja”, meinte der, da mußte sehen, daß Du dir irgendwo eine klaust." Das waren die Zustände in der Grube. Wir waren auch noch gar nicht weit, da kommt ein Pole auf mich zu und spricht “Du, Schaufel?” Ich sagte, “Ich habe keine” und Wumms, hatte ich schon ein paar Schläge ins Gesicht, daß ich dachte, Ostern und Pfingsten fällt auf einen Tag. Na, ich habe dann mit dem noch einmal eine Differenz gehabt, wo er mich wieder zusammenschlug und mußte ich wieder nach einer Schaufel Umschau halten. Zum Glück fand ich dann ein Stück weg eine Schaufel an der Seite stehen und war dessen wenigstens sicher, daß ich nicht nochmals Schläge bekam.
Ich hatte mir dabei die Nieren runtergeschlagen, wo ich über die Kohle flog und meldete mich den nächsten Tag krank. Bin dann einige Tage wieder im Haus gewesen, aber dann mußte ich eben wieder einfahren. Und jetzt kam ich in die Nachtschicht. Und jetzt war dieser Lump, der mich dort zusammengeschlagen hat, ausgerechnet auch in die Nachtschicht versetzt worden. Es war ein gewisser Kraftschik, ein junger Mensch, der viele, viele so zusammengeschlagen hat. Er hat einem zum Beispiel, der mit einem künstlichen Auge da war, so geschlagen, daß das Auge, das künstliche Auge, in den Dreck gefallen ist. Das Auge wurde nicht wieder gefunden und der Kriegsgefangene, der lief mit einer Augenhöhle herum. Diese Zustände waren bei den Polen.
Jetzt hatte ich in der 5. Abteilung in der Nachtschicht wieder ganz schwere Arbeit zu vollbringen, aber es erübrigt sich, daß erst zu erwähnen, denn Ihr würdet es ja doch nicht richtig verstehen. Inzwischen war der Steiger, der bei uns war, tödlich verunglückt. Es war auch ein großer Schweinehund. Er war durch einen Stollen gekrochen, wo keine Luftzuführung mehr war, also ein stillgelegter Stollen. Dabei ist er von tödlichen Gasen überfallen worden und ist dort gleich gestorben. Dann kam ein anderer Steiger in die 5. Abteilung, ein gewisser Zachlund, den ich schon von Anfang an von der 13. Abteilung aus kannte. Der sagte bloß zu mir: “Nu, sag mal, was machst Du denn hier?” “Tja”, ich sag, “was soll ich denn machen?” Er meinte, “Du gehst doch hier kaputt!” “Tja”, ich sag, “das weiß ich sowieso.” “Na ja, du kommst sofort von hier weg, denn das ist hier keine Arbeit für Dich.” Dadurch bin ich in eine andere Abteilung gekommen, wo ich zwei Zughaspeln bediente.
Dort hatte ich allerdings auch zweimal ein Unglück, daß von oben Wagen runter gelassen wurden, ohne diese ans Seil zu legen. Dadurch habe ich im letzten Moment mich nur durch einen Sprung nach der Seite noch retten können, sonst wären mir beide Beine abgeschlagen worden. Das soll auch nur noch mal ein Beweis sein, wie “herrlich” es in der Grube gewesen ist und wie es dort zugegangen. Später hatte ich mit dem einen Aufseher auch noch mal wieder Differenzen; da hatte er angeordnet, die Wagen sollten so und so, und ich sagte “Nein”, aber er bestand darauf und schon war das ganze verbaut. Da kriegte ich von dem auch noch mal Dresche. Ja, also, ich bin ja aber trotzdem noch glücklich herausgekommen.
Die Ausreißer
Nun sind ja auch verschiedene ausgerissen. Und das war dann immer großes Hallo. Es ist unter anderem einer ausgerissen, der sich in einen Kohlenwagen gelegt hatte und andere hatten ihn mit Holz zugedeckt. Dadurch wurde er als Holztransport nach dem Holzplatz befördert und ist entkommen.
Aus meiner Stube war ein gewisser Pirnich, der auch ausgerückt ist und der mir sagte, “komm mit”. Ich habe ihm nur geantwortet, “Daß hat keinen Zweck, ich bin viel älter wie du, und ich bin dir nur hinderlich.” Ob er durchgekommen ist, weiß ich nicht, gehört habe ich aber auch nichts. Nur der Kommandant wollte mich daraufhin erst einsperren lassen, weil er glaubte, ich wüßte etwas. Ich habe aber das abgestritten, und da bin ich auch noch einmal davongekommen.
Ein anderer gelungener Fluchtversuch, war der, daß ein Gefangener in dem Dachgebäude Malerarbeiten verrichtete. Und da hatte der eine Angestellte seinen Mantel dort hingehangen. Der Kriegsgefangene hatte das gemerkt, hatte sich den Mantel geschnappt, angezogen, ist als Zivilist dort weiter gelaufen und ist auch davongekommen.
Ein anderer hatte geschrieben, er hatte sich auf einen Kahn gerettet, der die Oder runter fuhr, und da schrieb er uns mal, “nach glücklicher Seefahrt” ist er glücklich angekommen.
Ein anderer Gefangener war ausgerissen und wurde entdeckt und ins Lager zurückgebracht. Den haben sie dermaßen zerschlagen, daß er mit gebrochenen Beinen, wer weiß wie lange gelegen hat.
Wieder ein anderer Fall ist auch noch zu erwähnen. Der wurde wieder zurückgebracht und erklärte frei und offen “Und ich rücke ein zweites mal aus.“Na, er hat es auch tatsächlich gemacht und da war er bereits auf tschechischem Gebiet, wo ihn Hunde einer Streife gestellt haben, denn er war auf einen Baum geklettert. Er wurde auch wieder zurückgebracht und sagte “Und ich rücke ein drittes mal aus.” Und dieser Mann ist der erste, der von uns allen aus dem Lager entlassen wurde.
Nachtrag
Es wäre vielleicht noch zu erwähnen, daß da die Woche ja sieben Tage hatte, auch an sieben Tagen in die Grube eingefahren wurde. Wir hatten vielleicht innerhalb eines ganzen Jahres zwei freie Tage. Wie ich vorhin schon erwähnte, war ich drei Jahre ununterbrochen in der Nachtschicht. Gegen acht Uhr mußten wir heraustreten, und dann ging es zur Grube, wo ein Weg von ungefähr 20 Minuten zurückzulegen war. Die Ausfahrt war auch nicht früh um sechs Uhr, sondern wir kamen ungefähr so gegen acht Uhr endlich in das Lager zurück. Dann etwas gefrühstückt und versucht, in das Bett zu kriechen, wobei du aber immerfort gestört wurdest, weil inzwischen sich die Mittagsschicht schon wieder fertig machte und die Frühschicht zurück kam, so daß an Schlaf sehr wenig zu denken war. Ich habe vielleicht in der Zeit, wenn ich viel geschlafen habe, fünf Stunden geschlafen.
Außerdem hatten wir eine außerordentliche Wanzenplage, denn die Wanzen haben uns buchstäblich bald aufgefressen. In der ganzen Zeit, wo ich im Lager war, ist das Stroh einmal gewechselt worden, da kannste nun sicher vorstellen, was da für ein Ungeziefer sich eingenistet hatte. Die Zeit, wo du im Lager warst, kam es auch immer wieder dazu, daß wir zum Arbeitskommando heraus gerufen wurden, zum Holz abladen und dergleichen. Das war auch noch eine sehr schwere Arbeit, aber wir waren ja nur die Gefangenen, mit uns konnten sie ja alles machen, was sie wollten.
Die Verpflegung war außerordentlich einseitig, die erste Zeit hatten wir fast ständig dreimal täglich dicke braune Bohnen, Rübenschnitzel und solches Zeug. Also es war bestimmt kein leckeres Mahl. Dann, später, gaben sie uns Pferdefleisch in allen möglichen Formen. Von der Gefangenschaft wäre nur noch zu berichten, daß wir ab Dezember 1948 zehn Prozent unseres Verdienstes gutgeschrieben erhielten und uns dafür in der Kantine etwas kaufen konnten. Die übrige Zeit, die ganzen Jahre vorher haben wir nichts erhalten. Wir waren im Lager reichlich 500 Mann, ich hatte die Nummer 506.
Die Entlassung
Wir durften im Lager ungefähr alle vier Wochen einmal schreiben. Und da hatte ich im Oktober ‘48 geschrieben, “unsere Silberhochzeit kann nun nicht stattfinden, weil einer der Beteiligten fehlt.” Ich wurde plötzlich eines Tages nach der Schreibstube gerufen, und da wurde ich gefragt, wann ich geheiratet habe. Da habe ich ihm erklärt, daß ich am 22. Dezember 1923 geheiratet habe. Da wurde mir geantwortet “Nu, du Idiot! Das konntest du doch eher sagen, da wärste doch entlassen worden!” Ich antwortete “Ich freue mich über jeden, der entlassen wird, und solange wird es ja auch nicht mehr dauern, da werde ich ja auch drankommen.” Nun hatten sie es wieder doch verstanden, die ganze Sache noch ein viertel Jahr hinzuzögern, bis ich dann endlich im Februar, März 1949 auf der Liste stand, die entlassen wurden.
Ich kam daraufhin zu 14 Tage nach Fürstenwalde an der Spree in Quarantäne und dort wurden wir erst geschult, über die Verhältnisse wie sie jetzt in Ost-Deutschland herrschten. Das war dann, nachdem ich von dort wegkam, meine erste Zusammenkunft mit Dir, Manfred, und mit Ursula, im Johannesstift Berlin. Bevor ich nach Ebersdorf weiter reiste bin ich im Johannestift noch 2 Tage bei Deinem Heimleiter geblieben. Ihr habt mir geraten, hier in West-Berlin zu bleiben, da die Verhältnisse in der DDR nicht so günstig waren. Ich habe das aber nicht verstanden, denn die wenigen Informationen die wir in der kurzen Zeit in Fürstenwalde bekamen waren ja nur auf die DDR abgestimmt. Außerdem wollte ich so schnell es ging zu Martel. So, das soll für heut’ genug sein.
Die Heimkehr
Aushilfstätigkeiten
Am 8. März 1949 kehrte ich nun nach vierjähriger Trennung nach Ebersdorf. In dem kleinen Ort Ebersdorf bekam ich selbstverständlich keine Stellung und mußte Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Ich glaube, ich habe knapp 70 Mark im Monat erhalten. Durch Holzhacken, Kohlen holen, Garten umgraben und dergleichen verdiente ich mir etwas Geld. Auch war ich für die Wäscherei Bernhard etwas tätig, indem ich so einige Buchführungsarbeiten machte und auch Wäsche von dort ausfuhr.
Im VEAB
Im September 1949 bekam ich dann in Lobenstein eine Aushilfeanstellung beim VEAB, also beim Volkseigenem Erfassungs- und Aufkaufbetrieb, welcher die landwirtschaftlichen Produkte und dergleichen aufkaufte. Es war die Abrechnung, wenn die Bauern Getreide einfuhren, daß ich das machte. Es dauerte aber nicht lange, dann hatten die doch gemerkt, daß ich auch vom Getreide etwas verstand und es wurde mir gesagt, ich soll ein Getreidelager, welches neu eingerichtet würde, in Hirschberg an der Saale übernehmen. Nun war ich allerdings wieder reichlich getrennt, denn die Verbindung Hirschberg – Ebersdorf war sehr ungünstig. Andererseits war ich aber froh, daß ich endlich etwas mehr verdiente und eine Stellung erhielt. Folglich sagte ich zu.
Ich besorgte mir in Hirschberg ein möbliertes Zimmer und wir bekamen, ich hatte noch drei Leute dazu, dann Getreide zum Einlagern in der dortigen Lederfabrik auf zwei oder drei Etagen. Ich hatte dort insgesamt ungefähr 22000 Zentner Roggen eingelagert, die regelmäßig umgeschichtet werden mußten, damit sich nichts durch die Restfeuchte erwärmt. Gegen Anfang 1951 bekam ich die Nachricht, daß eine Strukturänderung eingetreten sei und ich wurde nach Ziegenrück versetzt, also in der gleichen Eigenschaft, als Lagerleiter. Aber da war bereits ein Lagerleiter, so daß wir zwei uns also nur gegenseitig auf den Füßen rum traten. Es dauerte auch nicht lange, es waren nur wenige Wochen, dann wurde mir direkt gekündigt.
Bei der HO
Ich habe dann bei der Handels Organisation in Schleiz , eine Aushilfsstellung erhalten, weil die HO eine Buchprüfung hatte und für die Revisionen benötigten sie noch jemand. Nun ereignete sich etwas recht sonderbares. Ich bekam eine Arbeit, irgendeine Aufstellung und dergleichen, und als ich damit fertig war und der Revisor kam und betrachtete sich das, da war er erstaunt, daß die Aufstellung bereits auf dem ersten Anhieb bis auf den Pfennig gestimmt hatte. Da wurde er recht stutzig und meinte “Sie müssen bei uns bleiben. Sie müssen mit in unsere Revisionsabteilung.” Ich glaube, die war in Erfurt oder so, daß weiß ich nicht genau. Inzwischen war aber wieder herausgekommen, daß die Verwaltung der HO in Schleitz nach Greiz verlagert wurde, so daß ich dann nach Greiz hätte ziehen müssen. Inzwischen wurde aber in Ebersdorf die Deutsche Handelszentrale Lebensmittel eingerichtet, als vollständiges Auslieferungslager für den gesamten Kreis Lobenstein. Ich habe mich dort sofort beworben und wurde dort als Buchhalter angenommen. Also ich fing wieder praktisch von unten an. Allerdings war ich nun endlich mit Martel vereint und hatte nicht wieder auswärtig eine Stellung.
Gehaltserhöhung
Es war ein an sich schönes Arbeiten, und es hat ja auch einige Komplikationen gegeben. Denn Ich erinnere mich, daß eines Tages unser damaliger Direktor Heinz Hahn zu mir sagte, ich möge mal zu ihm in sein Zimmer kommen. Wir hatten vorher eine Betriebsversammlung gehabt, und da hatte er, also Hahn, verschiedene Unstimmigkeiten aufgedeckt beziehungsweise Reklamationen. Er sagte mir dann, in seinem Zimmer “Du wirst gemerkt haben, daß ich heute etwas aggressiv gewesen bin und daß mir so manches nicht paßt. Auch an Dir gefällt mir etwas nicht.” “So, " sagte ich, “na, dann man raus mit der Sprache.” Da sagt’ er “Ja, dein Gehalt gefällt mir nicht. Du bist ab jetzt zwei Stufen höher eingestuft.” Ich habe ihm darauf nach einem “Dankeschön” nur noch geantwortet, wenn ihm wieder etwas so an mir nicht gefällt, dann möge er mich hoch rufen lassen.
Die Revisoren
Inzwischen hatten wir auch eine Revision von Erfurt aus, und meine Spürnase sagte mir, hier auf dem einem Konto, daß etwas nicht stimmt. Ich sagte das den Revisoren und die betrachteten sich das alles und sagten “Ja, wir können aber nichts unrichtiges feststellen.” Nun schön, nach einigen Wochen kam aber, das war auch noch gar nicht so lange Zeit her, doch heraus, daß unser Oberbuchhalter dort falsche Buchungen vorgenommen hatte und eine Rechnung nicht gebucht hatte, dafür aber den Wareneingang auf verschiedene Konten verbucht hatte. Es betraf eine Lieferung von Margarine. Nun hatte ich doch Recht und erklärte das. Unser Oberbuchhalter war inzwischen weggegangen, denn er wäre wahrscheinlich sowieso entlassen worden, und er kann noch von Glück reden, daß er nicht wegen Bilanzverschleierung in Anspruch genommen worden war. Ich mußte nun das rehabilitieren, also alles rückrechnen und habe das alles so richtig gestellt und mußte damit nach Erfurt zur Stelle, wo die Revision saß. Ich habe denen das dort erläutert, und da staunten sie nur und sagten in Gegenwart unseres Direktors Hahn “Ja, hier ist aber für den Kollegen Tusche auch eine Prämie fällig.” Da sagte Hahn bloß “Selbstverständlich” und ich bekam eine Prämie von 200 Mark.
Planungsleiter in Rudolstadt
Inzwischen war aber schon wieder eine Änderung im Gange indem unser Lager in Ebersdorf als Auslieferungslager nur noch galt und von Greiz aus die Verbuchungen und alles vorgenommen wurden. Kurz darauf kam eine weitere Änderung, daß Rudolstadt für uns maßgebend war. Und so gehörten wir dann wieder zum Bezirk Rudolstadt. Nach wiederum kurzer Zeit wurde eröffnet, das Lager in Ebersdorf wird ganz aufgelöst und es wird alles von Rudolstadt aus erledigt. Das hieß also mit anderen Worten, daß uns allen gekündigt wurde.
Mir wurde nicht gekündigt, sondern unser Direktor, der Rudolstadter, erklärte, daß er mich nach Rudolstadt nehmen möchte, ob ich bereit wäre. Ich sagte ihm nur “Ich bin nicht an Ebersdorf gebunden” und so siedelte ich erstmal alleine nach Rudolstadt um. Es war mir die Wahl gestellt, ob ich in der Planung tätig sein wollte oder in der in der Finanzbuchhaltung. Ich entschied mich für die Planung und nach einigen Wochen war ich Planungsleiter in Rudolstadt. Dadurch hatte ich nun mich wieder hochgearbeitet. Es war allerdings noch das eine, daß ich immer noch getrennt war und bloß alle acht oder 14 Tage nach Ebersdorf zurück kam, bis wir dann im Jahr 1955 in Rudolstadt eine Wohnung bekamen, die Du Manfred ja noch kanntest, weil Du uns ja dort einige Male besucht hattest. Ich gehörte in Rudolfstadt in die Geschäftsleitung, hatte Bankvollmacht und hatte auch ein ganz anständiges Gehalt, bekam auch bald die erste Leistungsstufe und es gab ja auch viel Unannehmlichkeiten dabei und sonst irgendwas so, das kannst Du Dir ja vorstellen.
Der Republiksieger
Aber an eins muß ich mich noch ganz besonders erinnern. Es gab doch dann immer diese Wettbewerbe innerhalb der ganzen DDR, wo dann die Prämien verteilt wurden. Die Auswertung der einzelnen Vierteljahre erfolgte in Berlin in der Hauptzentrale. Und, wer mußte nach Berlin fahren? Ich. Ich habe dort die Argumente alle vorgebracht, kam nach Rudolstadt zurück und sagte unserem Direktor Bein “Wir sind Republiksieger!” Da staunte er bloß.
Dasselbe ist noch einmal passiert in demselben Jahr, zwei Quartale später, wo ich wieder nach Berlin fuhr und wieder den Republiksieger nach Rudolstadt brachte. Ein Vertreter von Berlin, der dann zu uns nach Rudolstadt kam, erklärte nur noch zum Direktor Bein “Ja, einen besseren Vertreter als ihren Kollegen Tusche konnten sie ja auch nicht nach Berlin schicken. Er hat gekämpft mit allen Mitteln und ist eben Sieger geworden.” Das war auch die Zeit, wo ich dann wieder zu Geld kam, denn ich erhielt innerhalb eines Jahres zweimal je 850 Mark Prämie und sonst gab’s auch immer etwas jedes Vierteljahr.
Die Rentenzeit
Wie es in Rudolstadt war, weißt Du ja auch etwas, da Du uns ja besucht hattest. So sind die Jahre in Rudolstadt dann dahingegangen bis das Jahr 1965 erreicht war und ich in die Reihe der Rentner aufgenommen wurde. Ich erhielt eine Rente von monatlich 263 Mark und wurde allgemein als “guter” Rentner bezeichnet. Da aber Mutti ja auch eine Rente von ungefähr 130 Mark erhielt, hätten wir ja auch einigermaßen leben können.
Umsiedelung in den Westen
Aber nun durfte ich 1965 das erste mal nach dem Westen fahren. Und von allen Seiten wurde mir dann immer wieder gesagt, ich soll nach dem Westen umsiedeln. Im Jahr 1967 haben wir dann den Schritt getan, es hat ungefähr fünf Monate gedauert, ehe wir die Ausreisegenehmigung erhielten. Wir haben nur noch auf Kisten gelebt, alles sortiert, alles notiert, und dann sind wir im November 1967 nach Köln übergesiedelt. Das Einzimmerappartement in Köln-Buchheim war für die vielen Möbel die wir mitgebracht hatten zu klein, aber wir haben ja auch für Euch einiges dabei gehabt, wie das Klavier die Standuhr usw. Das weitere weißt Du ja am besten selbst, denn Du hast ja das alles mitgemacht. Selbstverständlich haben wir diesen Schritt nie bereut, denn es war doch ein ganz anderes Leben als in der DDR und ich hatte nach den Anfangsschwierigkeiten hier doch das geschafft, was wir uns erträumt hatten.
Ich hatte zwar auch einige Schwierigkeiten dahin, daß ich mit der Rente nicht ganz einig wurde. Die hatten mich in die Beschäftigungsgruppe 3 eingegliedert und damit war ich nicht zufrieden und bin da vor’s Arbeitsgericht gegangen, denn bei einer Rückfrage bei der Versicherungsanstalt wurde mir gesagt, ich käme ohne weiteres in die Gruppe 2 da ich immer Bankvollmacht hatte. Das ist auch dann der Fall gewesen und dadurch war meine Rente von Anfang an ungefähr 40 Mark höher.
Um bei nachlassender Gesundheit nicht in Schwierigkeiten zu kommen, habt Ihr uns eine Zweizimmerwohnung mit Küche und Balkon in einem Altenwohnheim in Porz besorgt. Die Lage war ausgezeichnet, Geschäfte, Ärzte, Straßenbahnanschluß und nicht weit bis zu Euch nach Ostheim . Wir haben hier eine schöne Zeit verbracht, auch konnte uns Ursula jedes Jahr aus der DDR besuchen und bei uns wohnen.
Die Sehschwäche und später Gelenkrheuma im Knie haben die Lebensfreude geschmälert. Durch die Möglichkeit, vom Haus versorgt zu werden und zusätzlich die Betreuung von einer ausgebildeten Roten-Kreuz-Schwester haben mich die letzten 3 Jahre nach Martel’s Tod über die schwere Zeit geholfen.
Nachtrag
Vater hat 1973 seinen ersten Herzinfarkt erlitten. Im Februar 1986 hatte er dann einen Schlaganfall. Da er einseitig gelähmt war und sich nicht mehr selbst helfen konnte mußten wir ihn in die Pflegeabteilung im Nebenhaus unterbringen. Nach nur 14 Tagen später ist er an den Folgen des Schlaganfalls, 6 Tage nach seinem 86. Geburtstag gestorben, und wurde in Köln-Brück auf dem gleichen Friedhof wie seine Frau beerdigt. Die Gräber wurden von uns jedes Jahr gepflegt, aber nach 15 Jahren wurden sie eingeebnet.
– Manfred